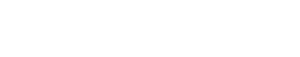In den vergangenen Tagen verursachten Blitzeinschläge mehrere Brände. Denn viele Gebäude haben keinen intakten Blitzableiter mehr. Schließlich schreibt die Landesbauordnung Blitzschutz nur in „baulichen Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind“, vor. Dazu zählen Hochhäuser, Pflegeheime oder Krankenhäuser. Experten warnen zudem vor Überspannungsschäden, die elektrische Geräte, Netzwerke und Computer zerstören können.
Statisch gesehen schlägt ein Blitz äußerst selten in ein Haus ein - zumindest, wenn es sich um ein normal hohes Gebäude handelt und wenn es nicht auf einem Hügel steht. Wenn höhere Gebäude, Bäume, Masten oder andere Häuser in der Umgebung stehen, ist nach Aussagen von Experten ein Sechser im Lotto wahrscheinlicher. Dennoch: Wenn einen dann doch der Blitz trifft, sind die Folgen meist dramatisch. Am Wochenende führten mehrere Blitzeinschläge im Raum Reutlingen zu Bränden. Ein Blitzableiter als äußerer Schutz vor der Naturgewalt hätte vielleicht Schlimmeres verhindern können. Regelmäßig müssen auch Stuttgarts Feuerwehrteams nach Blitzgewittern ausrücken und Brände löschen. Umso erstaunlicher ist, dass die Landesbauverordnung Blitzschutzanlagen nicht generell vorschreibt. Im Paragrafen 15, Absatz 2 heißt es nur: „Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.“ Im Klartext heißt dies: Ein- und Zweifamilienhäuser mit einer normalen Gebäudehöhe dürfen „oben ohne“, also ohne Blitzableiter sein. „Bei Hochhäusern oder wichtigen Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Krankenhäusern, in denen ein Blitzschlag lebenswichtige Geräte lahmlegen kann, ist Blitzschutz vorgeschrieben“, sagt Florian Gödde von der Berufsfeuerwehr Stuttgart.
Dennoch sollten Hausbesitzer und Verbraucher sich nicht auf die Rechtssprechung und das vermeintlich geringe Risiko verlassen, sondern unnötigen Schäden und Scherereien beispielsweise mit Versicherungen vorzeitig abwenden. Die Blitzschutzexpertenmachen darauf aufmerksam, dass der Blitzableiter keine umfassende Sicherheit gewährleistet. Er garantiert nur den äußerlichen Schutz: Wenige Millimeter dicke Drähte aus Stahl oder Aluminium, auf dem Dach oder am Schornstein montiert, sollen die Spannung eines ins Dach eingeschlagenen Blitzes in den Erdboden leiten. Hausbesitzer sollten bei der Installation darauf achten, dass auch Satellitenschüsseln und Fotovoltaik-Anlagen in den Schutz integriert werden.
Mindestens so wichtig wie der äußere ist der innere Blitzschutz. Bestimmte Vorrichtungen sollen die elektrischen Geräte im Haus vor Überspannungsschäden schützen. „Denn selbst Blitze, die in zwei Kilometer Entfernung in einen Strommasten einschlagen, können empfindliche Elektronikteile im Fernseher oder Computer zerstören“, sagt Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Blitzeinschläge erzeugen ein extrem starkes elektrisches und magnetisches Feld. Statt der gewohnten 230-Volt-Spannung jagen dann mehrere Tausend Volt durch die Strom- oder Telefonleitung - zwar nur für kurze Zeit, aber die Schäden können verheerend sein. Kurze Spannungsspitzen reichen, um die sensible Elektronik von Geräten zu zerstören und Netzwerke lahmzulegen. Dem beugen fachmännisch angebrachte Sicherungen vor, die am Hausverteiler, an den Unterverteilern und an einzelnen Steckdosen installiert werden.
Doch was passiert, wenn das Gebäude doch vom Blitz getroffen und beschädigt wurde? „Wenn der Blitz direkt ins Haus eingeschlagen und einen Brand ausgelöst hat, kommt normalerweise die Gebäudeversicherung für die Schäden auf“, sagt Grieble. Allerdings rät der Verbraucherschützer, die Verträge nochmals genau durchzulesen. In Ausnahmefälle werde ein Blitzableiter vorgeschrieben. Ähnlich verhält es sich auch bei Schäden durch Überspannungen. In der Regel sind die Schäden, über die Gebäude- und Hausratversicherung abgedeckt, aber: Nur wenn der Vertrag eine Klausel enthält, die Überspannungsschäden einschließt.