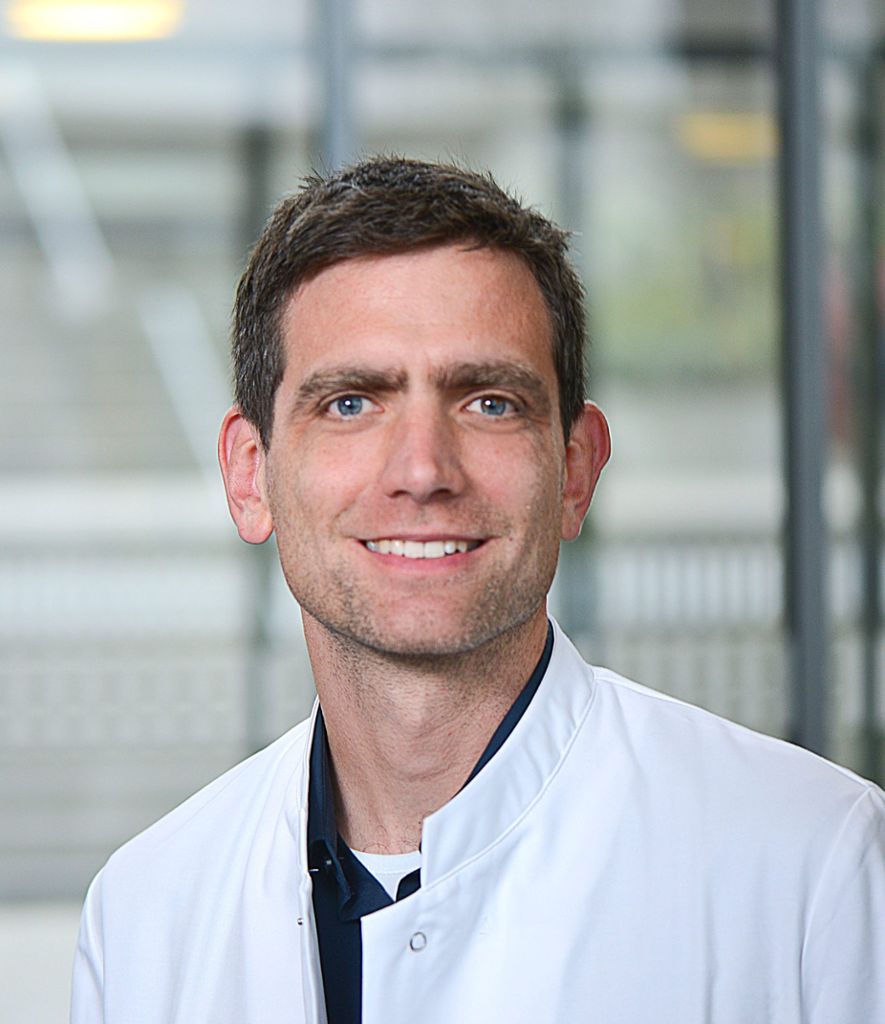Die Diagnose Krebs wirft jeden aus der Bahn. Nichts ist mehr so, wie es war. Wie sehr, zeigt sich oft erst nach dem ersten Schock, der Operation, der Chemotherapie. Man will selbst alles dafür tun, um seine Heilungschancen zu verbessern.
Die Diagnose Krebs wirft jeden aus der Bahn. Nichts ist mehr so, wie es war. Wie sehr, zeigt sich oft erst nach dem ersten Schock, der Operation, der Chemotherapie. Man will selbst alles dafür tun, um seine Heilungschancen zu verbessern. Man hört immer wieder, dass eine positive Grundhaltung dazu beiträgt. Aber was ist, wenn einem das nicht gelingt? „Eine Krebserkrankung ist verunsichernd. Aber es gibt Hilfsangebote“, sagt der Oberarzt Mark Christian Uhle, der am Klinikum Stuttgart Patienten mit einer Krebserkrankung zur Seite steht.
Hat die Psyche einen Einfluss auf die Entstehung von Krebserkrankungen?
Einerseits wissen wir heute, dass psychische und körperliche Vorgänge eng miteinander verwoben sind. So lassen sich beispielsweise durch Stress bedingte Veränderungen in der Zusammensetzung der an der Immunabwehr beteiligten Zellen aufzeigen und es deutet vieles darauf hin, dass die Immunabwehr eine Rolle bei der Entstehung von Krebserkrankungen spielt. Andererseits konnten direkte Zusammenhänge zwischen psychischem Stress und der Entstehung von Krebs in Studien bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. Indirekt spielt die Psyche aber insofern eine Rolle, als sie unser Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsverhalten beeinflusst; also beispielsweise ob und wie viel wir rauchen, ob wir vermehrt Alkohol trinken oder uns anderen Risikofaktoren für die Entstehung von Krebs aussetzen.
Häufig hört man ja auch, jemand sei an Krebs erkrankt, weil ihm der Stress auf den Magen geschlagen sei. Sind das nur schnelle Erklärungsmuster?
Es sind zumindest Erklärungsmuster, die der Komplexität der Sache nicht gerecht werden. Bei der Entstehung von Magenkrebs spielen (wie bei anderen Tumorarten auch) viele Faktoren eine Rolle. Entzündliche Erkrankungen der Magenschleimhaut gelten beispielsweise als Risikofaktor. Auch die Art der Ernährung und der Konsum von Alkohol und Tabakrauch spielen eine Rolle – Dinge, die wiederum dem Einfluss der Psyche unterliegen. Die Tatsache, dass bei weitem nicht jeder Mensch, der diese Risikofaktoren aufweist, auch an Krebs erkrankt, ist unter anderem durch die Bedeutung von genetischen Faktoren erklärbar. Inwieweit die Aktivität von Genen durch äußere, letztlich auch psychische Faktoren beeinflusst wird (Epigenetik), ist übrigens derzeit Gegenstand intensiver Forschung.
Manche Ärzte vertreten die Ansicht, dass die Psyche keinen Einfluss auf den Krebs hat, hat sie denn dann überhaupt einen Einfluss auf die Therapie, die Heilungschancen oder den Krankheitsverlauf?
Auch hier geht es letztlich um die Frage, inwieweit Psychisches Körperliches bewirken kann. Ein Einfluss auf den Krankheitsverlauf im Sinne von Heilung oder Verlängerung der Lebenszeit durch die psychologische Mitbehandlung von Krebskranken konnte in Studien nicht nachgewiesen werden. Wohl aber eine Verbesserung des subjektiven Befindens und damit der Lebensqualität. Auch die Verträglichkeit spezifischer Tumortherapien (zum Beispiel Chemotherapie) kann durch psychische Mitbehandlung verbessert und Schmerzen können reduziert werden. Indirekt kann psychisches Wohlbefinden eine positivere Einstellung gegenüber notwendigen Krebstherapien bewirken.
Und dann kommen auch noch Schuldgefühle dazu, weil man meint, die Therapie nicht gut genug zu unterstützen?
Schuldgefühle sind bei Betroffenen häufig. Sie können einhergehen mit dem Erleben, kein „guter“ Patient zu sein oder der Überzeugung, mit der Krebserkrankung für einen ungesunden oder „schlechten“ Lebensstil bestraft zu werden. Oftmals sitzen Schuldgefühle aber auch tiefer und lassen sich erst im Kontext biografischer Erlebnisse und als Ergebnis unbewusster Lösungsversuche verstehen.
Haben Sie Tipps, wie sich Betroffene durch solche schwierigen Phasen kämpfen können?
Sich zugestehen, dass eine Krebserkrankung eine Schocksituation darstellt, auf die man erst einmal keine Antwort weiß und die mit einer Verunsicherung in allen Lebensbereichen einhergeht. Für sich sortieren, zu welchen Menschen aus dem eigenen Umfeld man mehr Kontakt möchte, wen man hilfreich und unterstützend erlebt und umgekehrt. Mut dazu, sich von Dingen oder Mitmenschen abzugrenzen, durch die man sich aktuell belastet oder überfordert fühlt. Hilfsangebote nutzen, insbesondere auch psychoonkologische/psychosoziale Beratung, die im Klinikum Stuttgart beispielsweise jedem Patienten, der aufgrund einer Krebserkrankung stationär behandelt wird, niederschwellig angeboten wird. Auch im ambulanten Bereich gibt es viele Angebote, zum Beispiel von Krebsberatungsstellen oder Selbsthilfegruppen.
Neben der Eigeninitiative, was kann man als Arzt dem Patienten Gutes tun?
Offen und einfühlsam kommunizieren; dabei den Menschen hinter der Erkrankung mit seinen individuellen Bewältigungsmechanismen, Ängsten und Bedürfnissen wahrnehmen und respektieren. Sich dabei klar machen, dass das, was einem als Arzt möglicherweise selbst zur Routine geworden ist, für jemand, der betroffen ist, eine Ausnahme- und Krisensituation darstellt, die zu Reaktions- und Verhaltensmustern führt, die aus der Sicht des Arztes nicht unbedingt logisch oder „vernünftig“ sind. Und schließlich, daran denken und den Patienten darüber informieren, dass es Unterstützungsangebote im psychosozialen Bereich (zum Beispiel Psychoonkologie, Sozialdienst, Seelsorge, Selbsthilfegruppen) gibt.
Ein Mensch, für den ein Glas von Natur aus eher halb leer ist, muss also nicht für eine gute Prognose zu einem Menschen werden, für den es halb voll ist?
Nein. Ich kann mir auch schwer vorstellen, wie das „auf Knopfdruck“ gehen könnte.
Die Fragen stellte Sebastian Gall.